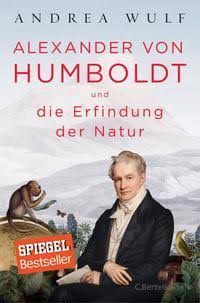
Die allseits hochgepriesene neue Biografie des wohl berühmtesten Naturforschers und Philosophen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist in der Tat äusserst informativ, spannend und unterhaltsam geschrieben, sowie unverzichtbar für das Verständnis der ‚Emanzipation’ der Philosophie von einer alles umfassenden Universalwissenschaft in eine anfänglich noch schwach ausdifferenzierte Naturwissenschaft.
Wulf geht weit über eine Biografie im engeren Sinn hinaus: sie platziert Humboldt nicht nur in der Umwelt und Gesellschaft, in die er hineingeboren wurde und gelebt und gewirkt hat; sie beschreibt und würdigt in separaten Kapiteln auch ausführlich die Wirkung von Humboldt auf ausgewählte ‚nachgeborene’ Forscher und Künstler; sie illustriert das konkret an den Wirkungen der Schriften Humboldts auf Darwin sowie an den Beispielen
- George Perkins Marsh (Autor von Man and Nature, Begründer und Promotor des Naturschutzgedankens, beeinflusste mit seinen Erkenntnissen über Zusammenhänge zwischen Wald und Lebensräumen die US-Politik massgebend);
- Ernst Haeckel (‚Erfinder’ des Begriffs und Konzepts der Ökologie) und
- John Muir (erster Erforscher des Yosemite Valley und geistiger Inspirator für die Schaffung und Pflege der National Parks in den USA).
Der rote Faden des ganzen Werks (inklusive reichhaltige Illustrationen, Anmerkungen und Fussnoten über 550 Seiten) ist Humboldts Leitgedanke, dass die gesamte Welt ein Netzwerk von miteinander untrennbar verbundenen, sich gegenseitig bedingenden und beeinflussenden Elementen ist; gemäss diesem Grundgedanken führt nur eine integrale – sowohl objektiv wissenschaftliche als auch philosophische und künstlerisch-emotionale – Betrachtung und Erforschung dieses Netzwerks zum ‚richtigen’ Verständnis unserer Welt.
Gemäss Wulf hat Humboldt postuliert, dass ein echtes Verständnis von ‚Natur’ nur in einer engen Verbindung von rational-wissenschaftlicher Beobachtung und Analyse von ‚Natur’ mit einer tiefen emotionalen Liebe zu ‚Natur’ möglich sei. Ob dies sich tatsächlich aus Humboldts Schriften ergibt, oder ob es eine sublimierte Schlussfolgerung der Verfasserin ist, kann ich nicht beurteilen. In jedem Fall erscheint mir diese These nicht als besonders glaubwürdig und gewiss nicht als zwingend. Eine tiefe Liebe der Natur, eine grenzenlose Bewunderung der Erhabenheit der Natur oder der Respekt vor den Wundern der Natur – im mikro- und makroskopischen Massstab – kann sehr wohl auch bei Menschen vorhanden sein, die keine Ahnung von Naturwissenschaft haben. Und umgekehrt kann eine wissenschaftliche Erforschung der Natur und der Vernetztheit aller natürlichen Phänomene auch völlig emotionslos betrieben werden. Ich vermute, dass sowohl Humboldt als auch seine Zeitgenossen und Nachfolger diese Verbundenheit von Wissenschaft mit Emotion primär der deutschen Romantik verdanken.
Der Untertitel «die Erfindung der Natur» tönt zwar reisserisch, ist aber ein Unsinn. Weder Humboldt noch sonst ein Wissenschaftler hat die ‚Natur’ erfunden; sie war schon vor Humboldt da und überlebt uns alle. Humboldt hat womöglich als erster die Natur der ‚Natur’ erkannt und beschrieben.
Eine weitere Kritik betrifft den inflationären Gebrauch des Begriffs und der Idee ‚Umweltzerstörung’. Der Mensch kann die Umwelt nicht zerstören – die Natur ist viel stärker. Er kann – leider – allerdings die Umwelt so verändern, dass sie für die Spezies ‚homo sapiens’ nicht mehr als Lebensraum dienen kann. Aber die Natur wird sehr wohl weiter bestehen, wenn der Mensch einmal ausgestorben sein wird. Es ist – für mich jedenfalls – nicht einsehbar, dass ausgerechnet unsere Spezies nicht dem Lebenszyklus aller anderen Lebewesen unterworfen sein soll. Die Gleichsetzung der Veränderung der Umwelt mit deren Zerstörung (als Lebensraum für Menschen) wiederspiegelt eine typisch anthropozentrische Sicht und basiert auf der Überzeugung, dass der Mensch ‚die Krone der Schöpfung’ ist. Sie ist auch in sich selbst widersprüchlich, indem sie ausgerechnet bei der Spezies ‚homo sapiens’ das Grundgesetz der Evolution ‚survival of the fittest’ ausser Kraft setzen will. Folgender Witz (nicht aus der Humboldt-Biografie) illustriert diesen Gedanken sehr plastisch:
Erde trifft Venus.
Venus zur Erde: «Du siehst aber schlecht aus.»
Erde: «Ich weiss; aber ich habe ‚homo sapiens’.»
Venus: «Geht vorbei.»
Mit diesen Überlegungen will ich nicht etwa die Sorge um die Umwelt kleinreden oder gar abwerten. Im Gegenteil: es geht mir darum, auf den Punkt zu bringen, worum es den Menschen in Wirklichkeit geht oder gehen sollte – nämlich um den Schutz unseres Lebensraums (bedingt möglich und sicher erstrebenswert), und nicht um die Rettung des Planeten (a priori unrealistisch und anmassend). Und es geht mir darum, dass wir mit etwas mehr Bescheidenheit ein Ziel anstreben, das in unserer Reichweite («you can’t grasp beyond your reach») bleibt. Nur so können wir die Menschen, die mitmachen müssen, für ihr Engagement und ausdauerndes Mitmachen gewinnen. Ausserdem bin ich davon überzeugt, dass es für die Menschen nützlich und sinnstiftend wäre, von Zeit zu Zeit daran zu denken, dass auch unsere Spezies endlich ist.
Trotz diesen kritischen Gedanken habe ich die Lektüre der Humboldt-Biografie sehr genossen. Sie illustriert hervorragend die Antriebskräfte, die Menschen wie Humboldt oder Darwin und zahllose andere bewogen haben, die Grenzen des Wissens stetig zu erweitern. Diese Pioniere haben, unter Berücksichtigung der Zeitumstände, der Reisestrapazen, der Ungewissheit des Überlebens, der Unkenntnis der Feindlichkeit der Menschen und Tiere, in deren Territorium sie vorstiessen, eine unstillbare Neugier, unvorstellbare Belastbarkeit und Leidensfähigkeit an den Tag gelegt, die grenzenlose Bewunderung erweckt und verdient. Allein die Tatsache, dass Humboldt um 1800, mit einem einzigen europäischen Begleiter, während mehr als fünf Jahren, im südamerikanischen Regenwald, in nicht kartografiertem und zuvor nie von einem Europäer betretenem Gelände unterwegs war, belegen, welchen Wagemut, welche Abenteuerlust und Beharrlichkeit Forscher wie Humboldt besessen haben müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Dabei
- hatte er keinerlei Kommunikationsmöglichkeiten mit Fachkolleginnen oder -kollegen,
- konnte er seine Erkenntnisse, die von ihm neu entdeckten Pflanzen und Tiere und seine durch systematische Beobachtung und Messung gewonnenen Forschungsergebnisse nur per Einweg-Kommunikation – sozusagen in einem schwarzen Loch – hinterlassen,
- ohne je eine Antwort aus Europa darauf erwarten zu können.
Die Humboldt-Biografie von Andrea Wulf hat mir ein neues und vor allem gründlicheres Bild der Zeit der Entdeckungen vermittelt. Der kant’sche Appell, die eigene Unmündigkeit zu überwinden und zu verlassen, sein Imperativ ‚sapere aude’ bekommt durch Menschen wie Humboldt eine sehr konkrete Ausprägung und animiert unwiderstehlich dazu, auch heute noch die Welt mit offenen Augen anzusehen und die Bereitschaft aufzubringen, bei jeder Entwicklung einen offenen Ausgang anzunehmen.