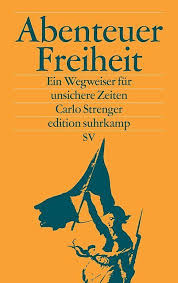
Strengers Essay umfasst – inklusive Fussnoten/Anmerkungen – nur 123 Seiten. Der Text ist aber sehr dicht und hochkonzentriert; andere Autoren könnten den gleichen Inhalt mühelos auf 500 Seiten aufblähen. Strenger sei Dank, dass er darauf verzichtet.
Der Inhalt des Essays ist:
- einführende philosophische Begründung für die Bedeutung von Freiheit und Demokratie für die ‚westliche’ Zivilisation:
- Freiheit und Demokratie sind höchste kulturelle Leistungen (hart erkämpfte Errungenschaften) der Menschen.
- Freiheit und Demokratie sind also weder vom Himmel heruntergeschwebt noch selbstverständlich.
- Es bedarf jederzeit expliziter und gezielter Anstrengungen, um Freiheit und Demokratie zu erhalten, und dauerhafter sorgfältiger Pflege.
- Analyse, dass beide, Freiheit und Demokratie, gefährdet sind; Strenger’s Hauptursachen:
- Freiheit und Demokratie werden von der heutigen Gesellschaft als selbstverständlich und gewissermassen naturgesetzlich gegeben betrachtet.
- Freiheit und Demokratie werden von der heutigen Gesellschaft in den Hintergrund gedrängt und durch totale Ansprüche an das private und mühelose Glück verdrängt.
- Glück erhält zunehmend den Status eines Grundrechts – jeder soll es haben; die Gesellschaft ist dafür verantwortlich.
- Die Bereitschaft, vor allem junger Menschen, sich für Freiheit und Demokratie einzusetzen, ist am Schwinden.
- Weitere gesellschaftliche Strömungen (Hedonismus, Ich-Bezogenheit und eine geradezu süchtige ständige Vergleicherei mit ‚den Besten’ und das daraus abgeleitete Streben nach Perfektion induzieren berufliche und familiäre Belastungen, die einen Einsatz für die Gesellschaft und das Gemeinwohl erschweren oder in den Hintergrund verbannen.
- Deshalb sind Freiheit und Demokratie in Gefahr, zu verschwinden und durch kulturelle, wirtschaftliche oder machtbezogene Leistungen und Ansprüche anderer Zivilisationen verdrängt zu werden
Hinweise, wie unsere Gesellschaft wieder zum Konsens gelangen könnte, dass es sich lohnt, Freiheit und Demokratie als Errungenschaft und grossartige zivilisatorische Leistung zu schätzen und zu verteidigen, und wieder Kraft und Energie dafür einsetzt, diese Werte – auch in Konkurrenz zu anderen Wertesystemen – mutig zu verteidigen und weiter zu entwickeln, finden sich im ganzen Essay verstreut. Insofern ist der Untertitel ‚Wegweiser für unsichere Zeiten’ ein zu grosses Wort.
Dies reduziert den Wert des Essays jedoch kaum. Es bedeutet einfach, dass man den ganzen Essay lesen sollte, am besten von vorn nach hinten, mindestens so konzentriert, wie er geschrieben ist, mit wachem Verstand, und mit selbst- und gesellschaftskritischen Augen.
Eine Kritik will ich nicht unterdrücken: die Sicht von Strenger, auch der geschichtliche Rückblick, ist streckenweise stark psychologisierend; auch seine Referenzpersonen wurzeln häufig in der Psychologen-Küche. Das macht seine Analyse nicht falsch, sondern höchstens unnötigerweise einäugig begründet. Aber: Strenger ist Professor der Psychologie – kann man ihm also diese Berufskrankheit nicht allzu sehr übel nehmen.
Als Bestätigung für meine Beurteilung füge ich die Besprechung dieses Essays von René Scheu (Feuilleton-Chef der NZZ) an.
Das Glück der Freiheit
Die liberale Welt ist ein zerbrechliches Gebilde. Zeigt sich ihre Schönheit nicht gerade in unsicheren Zeiten? (René Scheu, NZZ, 14. Februar 2017)
Das Glück kann nur von oben kommen: Glauben wir insgeheim alle wie Kinder an eine quasi-elterliche Instanz, die unsere Probleme löst? Der Mensch, dieses hochbegabte Tier, hätte auch nicht entstehen können. Dass er sich später kulturell entwickelte, war das Werk wohl seines Handelns, wenn auch nicht seiner Planung. Ein halbwegs friedliches Dasein in politischen Grosskörpern, genannt Staaten, war in den letzten Jahrhunderten eher die Ausnahme als die Regel. Auch im 21. Jahrhundert lebt nur eine kleine Minderheit der Menschen in demokratischen Verhältnissen. Eine freie Lebensart bleibt bis auf weiteres der grösste anzunehmende Glücksfall. Wenn diese Kurzbeschreibung stimmt, dann zeigt sie vor allem eins: Was wir im Westen als Normalität betrachten, könnte ebenso gut nicht sein. Und was leicht auch nicht sein kann, kann jederzeit wieder verschwinden.
Carlo Strenger, Philosoph und Zeitdiagnostiker, bringt uns in seinem neuen Buch «Abenteuer Freiheit» die Kontingenz einer freien Welt eindringlich zu Bewusstsein. Dabei verfährt er beschreibend und ermahnend zugleich. Die unterschiedlichen Tonlagen haben mit dem Grundbefund zu tun, der am Anfang seiner Betrachtung steht: Liberal-demokratische Ordnung und Gebrauch der Freiheit bedingen sich wechselseitig. Nur wo das Gefüge von Grundfreiheiten, Rechtsstaat und Demokratie gegeben ist, können sich Individuen entfalten und nach ihrer Fasson glücklich werden. Wenn das Verständnis und das Engagement des Einzelnen für die westliche Kultur jedoch schwinden, sieht sich Letztere in ihrem Fundament bedroht. Strenger, der sich selbst als Linksliberalen bezeichnet, argumentiert hier streng ordoliberal: Die freiheitliche Ordnung lebt von kulturellen und mentalen Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann.
Die Stresstests
Der Westen reagiert auf Stresstests wie Flüchtlingskrise und islamistischen Terrorismus mit Durchhalteparolen, die den Charakter von Autosuggestionen haben. Und die etablierte Politik verschliesst seit Jahren die Augen vor ihren grössten selbstfabrizierten Herausforderungen: Staatsverschuldung, Überalterung der Gesellschaft, geopolitischer Bedeutungsverlust, Vernachlässigung der Infrastruktur, Bildungsmisere. Man könnte den Eindruck gewinnen, als bestehe ein stillschweigender Konsens darüber, die grossen Fragen nach Möglichkeit auszublenden. In Wahrheit ist jedoch eine perspektivische Täuschung am Werk: Wer sich an beispiellosen Wohlstand, Ausweitung der Konsumzone und Rundumabsicherung in allen Lebenslagen gewöhnt hat, erkennt im feinen zivilisatorischen Gebilde, das ihn trägt, einen zweiten Naturzustand.
Als Ideal gilt das reibungslose Dasein. Politik beschränkt sich auf die Bewirtschaftung von Problemnuancen. Und so leben die Wohlstandsbürger immer gleich weiter: Sie sind auf das Heute fixiert, kümmern sich um ihre Karriere, pflegen ihre Hobbys, halten sich fit, ziehen sich ins Private zurück. «Die Vorstellung, wir bräuchten existenzielle Anstrengungen jenseits von Sport und Diät», schreibt Strenger, «klingt Anfang des 21. Jahrhunderts anachronistisch.»
Doch trotz Erleichterungen und Entlastungen an allen Lebensfronten ist die grosse Entspannung im menschlichen Zusammenleben nicht eingekehrt. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt vielmehr: Der gesellschaftliche Binnenstress in Wohlstandskollektiven nimmt in Friedenszeiten nicht ab, sondern zu. Der zweite Naturzustand bringt tendenziell misslaunige Bewohner hervor, die die Empfindung hegen, es falle inmitten materieller, symbolischer und kultureller Fülle ausgerechnet für sie nicht genug ab. Die umsorgten Individuen konkurrieren um naturgemäss stets zu knappe Ressourcen wie Aufmerksamkeit und Anerkennung. Sie fühlen sich kaum je hinreichend gewürdigt, sie fühlen sich vielmehr gekränkt, zurückgesetzt, dauerdiskriminiert. Das Wohlbefinden hat sie nicht etwa müde gemacht, sondern hyperaktiv.
Wer die Dekadenzthese bemüht, um die politische Passivität westlicher Gesellschaften zu erklären, macht es sich deshalb nach Strenger zu leicht. Die Lust am Ekel über die westliche Kultur ist zwar wieder angesagt, aber irreführend. Das Abendland pulsiert geradezu vor psychopolitischer Energie und Dynamik, nur sind die Menschen mit ihren eigenen Egos statt mit dem gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang beschäftigt.
Aber natürlich trüben sich die Aussichten ein. Die ungestörte Friedenszeit neigt sich im Zeichen von Zuwanderung und Terror dem Ende zu, und deshalb stellt sich heute drängender als noch vor ein paar Jahren die Frage: Sind die Wohlstandsbürger bereit, einen neuen Blick auf ihre tatsächliche Lage zu richten, wenn sie ahnen, dass die liberale Ordnung auf dem Spiel steht? Und vermögen sie ihre Energien neu auszurichten, um das gute Leben hochzuhalten, gegen das sie sich lange so undankbar zeigten?
Wie verwöhnte Kinder
Wer die gegenwärtige Dynamik begreifen will, tut gut daran, sich an der Psychologie des verwöhnten Kindes zu orientieren. Strenger setzt der Dekadenzthese die Infantilisierungsthese entgegen und schreibt sich damit in eine illustre Denktradition ein, die von Tocqueville über Gasset bis hin zu Sloterdijk reicht. «Jemanden verwöhnen heisst, seine Wünsche nicht beschneiden, ihm den Eindruck geben, dass er alles darf und zu nichts verpflichtet ist», schreibt Ortega y Gasset in «Aufstand der Massen». Der verwöhnte Mensch überschätzt sich laufend selbst, weil er seine eigenen Grenzen nicht erfahren hat. Für ihn sind Leben und Glück nicht in erster Linie Aufgabe, sondern Anspruch.
Als praktizierender Psychoanalytiker ist Strenger mit modernen Krankheitsbildern vertraut. Was das verwöhnte Individuum quält, sind überhöhte Leistungserwartungen an sich selbst, die es aus dem Dauervergleich mit anderen gewinnt. In der gefühlten egalitären Gesellschaft der Gegenwart vergleicht sich jeder mit jedem, auch wenn er am Ende mit dem Ergebnis des Vergleichs nicht leben kann. Die meisten sehen sich als potenzielle Überflieger – und leiden zwangsläufig am eigenen Ungenügen, weil auch unter Gleichen nicht alle zu den Besten zählen können. Was bleibt, sind dann oftmals bloss Abstiegs- und Versagensängste.
Den Grund für das eigene Unglück sucht der verwöhnte Zeitgenosse jedoch für gewöhnlich nicht bei sich, sondern bei den anonymen Anderen. Wahlweise macht er die Politik, die Gesellschaft oder dasSystem für die eigene Unzufriedenheit verantwortlich. Unbewusst wendet er sich fordernd an eine abstrakte quasielterliche Instanz, die seine Sorgen per Knopfdruck zu beseitigen hat. Im tief verwurzelten Glauben, dass es für alle Probleme eine technische Lösung gebe, die sich delegieren lasse, zeigen sich für Strenger die letzten Reste einer allgemein geteilten Metaphysik. Sie erklärt zugleich das widersprüchliche Verhältnis der Wohlstandsbürger zu ihrer Politik: Ihr wird nichts zugetraut – und doch wird ihr alles zugemutet.
Das verwöhnte Selbst ist höchst empfindlich. Am liebsten würde es jedwede Kritik am eigenen Lebensstil verbieten. Genau das ist nach Strenger das Ziel jener Bewegung, die seit den 1980er Jahren unter dem Titel der Political Correctness die angelsächsischen und europäischen Hochschulen zu dominieren beginnt. Die privilegierten Orte, an denen Kritik und Kritikfähigkeit trainiert werden sollten, werden zum Hort einer Ideologie, die Denk- und Sprechverbote institutionalisiert. Damit verrät die Korrektheit die vielleicht wichtigste Einsicht der Aufklärung, auf die sie sich selbst beruft: Niemandes Ansicht ist über Kritik erhaben.
Wer sich gegen Kritik zu immunisieren versucht, indem er überall kulturellen Rassismus wittert, arbeitet letztlich jenen reaktionären Kräften in die Hände, die einen neuen Autoritarismus anstreben. Jeder Glaubenssatz, jede Verhaltensweise oder Wertsetzung darf, ja muss – auf argumentativer Basis – kritisiert werden können, sofern sie irrational oder unmenschlich ist. Die politische Korrektheit beruht nach Strenger auf einem folgenschweren Denkfehler: Sie unterscheidet nicht klar genug zwischen Person und Position, zwischen Mensch und Meinung. Ihr setzt er die «zivilisierte Verachtung» entgegen – die «Fähigkeit, zu verachten, ohne zu hassen oder zu dehumanisieren».
Die westlichen Demokratien müssen eine Streitkultur, die diesen Namen verdient, erst wieder erlernen. Strenger verschreibt dem Westen eine radikale intellektuelle Ernüchterungskur: Es ist höchste Zeit, sich von den vielen Selbsttäuschungen und Fremdbeschreibungen zu befreien, in die sich Universitäten, Medien und Politik in den letzten Jahrzehnten verstrickt haben. Nur wer es wagt, andere Kulturen und Lebensnormen zu kritisieren, kann auch die eigene Ordnung mit Überzeugung verteidigen.
Nüchtern werden heisst für Strenger zugleich erwachsen werden. Sein neues Buch ist als Plädoyer für psychische Reife zu verstehen. Dazu zählt er in erster Linie ein ehrliches Verhältnis zur Tragik menschlicher Existenz, mithin «die Anstrengung, mit der Wahrheit zu leben». Und was wäre die Wahrheit? Die liberale Ordnung ist nicht gottgegeben, sondern höchst fragil. Glück ist kein Geburtsrecht, das Leben kein Zuckerlecken. Wir alle sind verletzlich, altern und sterben. Aber wir haben hienieden mit etwas Glück einige Jahrzehnte zu bestreiten, die es als lohnenswert erscheinen lassen, an sich zu arbeiten und den inneren Freiheitsgrad zu erhöhen – trotz mannigfachen Rückschlägen.
Vertrauen und Skepsis
Das Menschentier steht einsam und verloren im weiten Universum, aber zugleich weiss es sich mit anderen verbunden, die sein Schicksal teilen. Keine Heilslehre wird es je erlösen. Aber es gibt anschlussfähige Sinntraditionen, die es sich zu eigen machen kann. Sie bieten ihm die symbolische Immunität, die es in seiner Verletzlichkeit braucht. Reife meint genau dies: eigene Überzeugungen entwickeln, ohne sie gleich im Himmel der ewigen Wahrheiten anzusiedeln. Wir glauben – und zweifeln zugleich. Wir vertrauen – und bleiben dennoch skeptisch. Wir arbeiten an der eigenen psychischen Form. Strenger zitiert Isaiah Berlin, der darin das Ideal der Freiheit erkannte: «Ziele zu wählen, ohne ewige Gültigkeit für sie in Anspruch zu nehmen.»
Dieses schwierige Leben ist der Preis für die freiheitliche Ordnung, deren Schicksal in unseren Händen liegt. Sie ist kein Konsumgut, sondern ein Erbe, das unseres Einsatzes – und unseres Einstehens – bedarf. Freiheit bleibt ein Abenteuer mit offenem Ausgang. Gerade in ihrer Zerbrechlichkeit besteht ihr Reiz. Wer die Schönheit erkennt, mag das zivilisatorische Wunderwerk nur bestaunen und auf ihr Fortbestehen hoffen. Oder er legt wie Carlo Strenger Hand an.