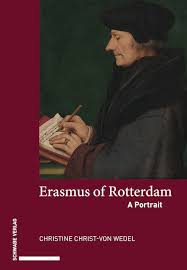
Im Klappentext des kleinen Buchs (A5, rund 170 Seiten Text) steht:
Erasmus von Rotterdam (1466/67-1536) zählt zu den noch heute weit herum bekannten Humanisten. Das hat gute Gründe, war er doch einer der bedeutendsten Publizisten seiner Zeit. Mit seiner griechisch-lateinischen Ausgabe des Neuen Testaments und seinen Bibelkommentaren und -auslegungen übte er eine kaum zu überschätzende Wirkung auf das damalige wie auch auf das spätere christliche Denken aus. Er beeinflusste Philosophen, Politiker, Literaten, Juristen, Pädagogen, Künstler und Musiker unterschiedlichster Richtung. Das Spektrum der Themen, mit denen er sich auseinandersetzte, ist breit: Krieg und Frieden, Politik und Menschenwürde, Rechtsprechung und Rechtsphilosophie, Kirchenmusik und Predigtlehre, Frömmigkeit und Lebensweisheit, Stilkunde und zivilisiertes Benehmen, Ehe- Frauen- und Erziehungsfragen. Erasmus prägte mit seinen Gedanken die Geistesgeschichte bis in unsere Tage.
Die Erasmusspezialistin Christine Christ-von Wedel führt mit leichter Feder in die Persönlichkeit ein, in das reiche und vielschichtige Denken des grossen Humanisten und in die Kämpfe und Sehnsüchte des Zeitalters der Reformation. In seinen Cartoons lässt Alfred de Pury die unterschiedlichen Ideen von Erasmus und Luther aufeinanderprallen.
Treffend. Das kleine Porträt – zu Recht nicht als ‚Biographie’ bezeichnet – macht Erasmus von Rotterdams Persönlichkeit und Wirken lebendig, indem es in kurzen, nicht systematisch chronologisch oder thematisch gegliederten Kapiteln beschreibt, was Erasmus geschrieben und bewirkt hat. Die Sprache von Christ-von Wedel ist leicht, auch bei wissenschaftlichen oder ‚exotisch-theologischen’ Fragen gut verständlich und lesbar. Die Autorin hat primär das Ziel, Erasmus ihren Leserinnen und Lesern als herausragende Persönlichkeit seiner Zeit näher zu bringen; sie schreibt also weder eine philosophisch-theologische noch eine historische Abhandlung. Ihre eigenen Texte untermalt sie mit zahlreichen Zitaten von Erasmus und dessen Zeitgenossen.
Leserinnen und Leser sollten allerdings bei der Auseinandersetzung mit der Zeit von Erasmus nie vergessen, dass in dieser Zeit nur eine ganz kleine Minderheit der Bevölkerung Lesen und Schreiben konnte. Die Auseinandersetzungen, von denen in diesem Buch die Rede ist, spielten sich innerhalb dieser kleinen Elite statt, obwohl deren Auswirkungen die ganze Bevölkerung betrafen.
Für mich persönlich ist Erasmus von Rotterdam – dank diesem Buch – eine grosse und wichtige Entdeckung. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass zu Beginn des 16. Jahrhunderts ein durch die damalige römisch-katholische Mönchsausbildung geprägter Mann derartig progressive Ideen entwickeln und vertreten könnte. Dies betrifft nicht seine theologischen Traktate – für mich weniger wichtige Themen –, sondern seine Theorien zur Staatskunde, zu den Mitwirkungs- und Mitentscheidungsrechten der Bevölkerung, zur Freiheit, zu den Menschenrechten, zur Toleranz gegenüber Andersgläubigen, zur Ausbildung und insbesondere zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und dies in einer Zeit, die noch durchaus durch die Vorherrschaft der Religion über das Säkulare, durch absolutistische Herrschaftssysteme sowie durch eine durchgehende Dominanz der Männer über die Frauen geprägt war.
Erasmus war mit seinem philosophischen, gesellschaftlichen und denkmethodischen Gedankengut seiner Zeit um Jahrhunderte voraus – und für seine Zeit und mehrere Jahrhunderte in die Zukunft hinein ein echter Revolutionär.
Ebenfalls bemerkenswert sind seine Ausführungen zum ‚richtigen’ Denken. Dies zeigt sich exemplarisch an seinen Theorien zur Auslegung ‚alter’ Dokumente, insbesondere der sogenannten Heiligen Schriften. Für ihn war ganz klar und zwingend, dass der Leser sich bewusst machen musste, dass «ihn Jahrhunderte von den Texten trennten. Ausleger sollten zunächst die biblischen Sprachen lernen, aber um die Bibelworte wirklich zu erfassen, genügte das nicht. Die Ausleger benötigen nach Erasmus gute Kenntnisse der Zeit, in der die Texte entstanden waren. Sorgfältig mussten sie analysieren, von wem die Texte stammen und an wen sie sich richten, um sie richtig einordnen und sie richtig verstehen zu können. Erst in einem nächsten Schritt gelte es, den wesentlichen Inhalt aus der zeitbedingten Schale herauszulösen und auf das eigene Leben und die zeitgenössische Gesellschaft anzuwenden. Das sei nur nach eingehendem Studium des Kontextes zu leisten, denn nicht alles könne einfach buchstäblich übernommen werden. Es gibt Abschnitte, die sollen sich nur an die Jünger und ihre Zeit richten, andere an alle. Einiges wird dem Empfinden der damaligen Zeit zugestanden, und über manches soll ironisch gelacht werden. Mit anderen Worten, Personen, Orte und Umstände der Zeiten, in denen die Bibeltexte verfasst wurden, sind daraufhin zu prüfen, ob und wie ein Wort sich an den heutigen Leser und seine Zeitgenossen richtet.» Das sind Grundsätze, die man nicht nur islamischen Fundamentalisten und Koranexegeten ins Stammbuch schreiben müsste, sondern ebenso sehr allen christlichen Fanatikern, die eine wortwörtliche Auslegung der Bibel postulieren, deshalb die Evolution ablehnen und davon überzeugt sind, das exakte Jahr der Erschaffung der Welt zu kennen. Die Welt wäre eine friedlichere, wenn Erasmus’ Empfehlungen seit 500 Jahren anerkannt und befolgt würden.
Erasmus bewegte sich sein ganzes Leben lang auf der Grenzlinie zwischen strenger römisch-katholischer Rechtgläubigkeit und Anerkennung des Papstes als oberster theologischer Autorität einerseits und den reformatorischen Ideengut, das er selbst massgeblich prägte, das aber auch von reformatorischen Eiferern und ‚Fundamentalisten’ wie Luther propagiert und teilweise mit kriegerischen Mitteln ausgebreitet wurde. Hinzu kommt, dass in der Zeit, in der Erasmus lebte und wirkte, die katholische Kirche immer noch eine ausserordentlich mächtige Sanktionsgewalt hatte; die Einstufung eines Denkers und Schriftstellers als ‚Häretiker’ oder gar die Exkommunikation hatte für einen unabhängig und frei lebenden Priester wie Erasmus durchaus existenzbedrohende Konsequenzen.
Für Erasmus galt, dass bei wichtigen theologischen Grundsatzfragen, bei denen sich die Wissenschaft nicht einigen konnte, Lösungen, die durch die kirchlichen Autoritäten traditionell als richtig anerkannt und durchgesetzt waren, zu akzeptieren waren. Dies ist ein Ausdruck seiner intellektuellen Bescheidenheit, die sich ganz klar und eindeutig von Luthers rechthaberischer Haltung unterschied; denn Luther vertrat in solchen Fragen den Standpunkt: «Hier entscheide ich – ich weiss es besser!»
Die Lektüre dieses Buchs lohnt sich unbedingt – auch immer wieder; es wird in Zukunft auf meinem Nachttisch liegen. Der Text will nicht linear von vorn nach hinten gelesen werden. Er lässt sich beliebig aufschlagen, 3-4 Seiten Lektüre sind erhellend und teilweise auch amüsant (Erasmus war sehr humorvoll und behandelte auch sehr ernsthafte Themen häufig mit einem grossen Schuss Ironie), dann kann das Buch wieder weggelegt und bei nächster Gelegenheit an einem anderen Ort wieder aufgeschlagen werden.
Die kürzest mögliche Charakterisierung von Erasmus – im Kontrast zu seinem anfänglichen Freund und Gesinnungsgenossen, später seinem erbitterten Gegner Luther – befindet sich in einem Cartoon von Alfred de Pury (Seite 171):
Luther: Bei mir heisst es ENTWEDER … ODER!!
Erasmus: Ich sage lieber: «Sowohl als auch!» – und im schlimmsten Fall: «Weder … noch!»