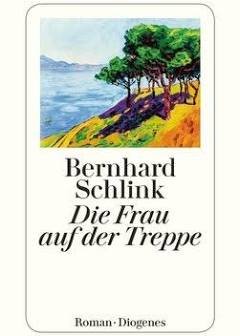
Benard Schlink, von dessen Werk ich bisher nur den «Vorleser» kenne, überrascht mich mit diesem Roman. Offenbar gibt es doch einige zeitgenössische deutschsprachige Autoren, denen es gelingt, eine spannende Geschichte mit leichter Hand zu erzählen, mit einem guten Schuss Ironie und ohne die permanente Sucht, Leserinnen und Leser mit Moral, Endzeitperspektiven, Nabelschauorgien und seelischen Sinn-Such-Odysseen erziehen zu wollen, nein, dazu als guter Mensch verpflichtet zu sein (Themen gäbe es ja im Überfluss: Drittes Reich und die Schuld, die jeder Deutsche deshalb mit leiddurchfurchtem Gesicht und schwer auf seiner Schulter lastend wie ein moderner Atlas mit sich herumtragen muss, Ossi-Wessi-Krebsgeschwüre, Gerechtigkeits- oder Verteilungs-Oden oder schwerblütige Geschichtsbohrungen in der deutschen Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft).
Schlink verirrt sich gelegentlich ein wenig auf diese Trampelpfade, aber er suhlt sich dort nicht, sondern begnügt sich mit wenigen Pinselstrichen, um immerhin zu zeigen, dass es das auch gibt, und dass er davon Kenntnis hat.
Schlink ist Jurist und machte in seinem Fach eine eindrückliche Karriere, bevor er sich – vorerst als Hobby – zum Schriftsteller mauserte. Seine Romane haben meistens einen expliziten juristischen Hintergrund. Im Wikipedia-Eintrag zu Schlink findet sich folgende Charakterisierung (von Dorothee Nolte) von Schlinks ersten Werken, einer Krimi-Trilogie mit der Hauptperson Selb:
«Es sind schwungvoll geschriebene, häufig witzige Romane, die – Ortskundige werden Strassen und Gebäude wiedererkennen – in Mannheim und Umgebung spielen; raffiniert gebaute Geschichten, in denen die politische Aktualität und die deutsche Vergangenheit präsent sind.
Schlink sieht das Schreiben von Kriminalromanen als Möglichkeit, selbst entworfene Rätsel zu lösen, was seiner Tätigkeit als Jurist vergleichbar sei. Zudem lasse sich in der Handlung Gesellschaftskritik verpacken.»
Die Story dieses Romans und Schlinks beruflicher Hintergrund erinnern unweigerlich an die Smith-Trilogie von Louis Begley. Allerdings: Die Bissigkeit und Wirklichkeitsnähe des amerikanischen Eventual-Vorbilds erreicht Schlink nicht.
Der namenlose Held, er ist als junger Anwalt bei einer renommierten Frankfurter Anwaltskanzlei tätig, des In Ich-Form erzählten Romans lernt die ‚Frau auf der Treppe‘ kennen. Die Frau auf der Treppe ist das zentrale Sujet eines Gemäldes, das der damals noch unbekannte Maler Schwind im Auftrag des äusserst erfolgreichen (des typisch deutschen Neureichen?) Geschäftsmanns Grundlach gemalt hat. Das Bild zeigt Irene, die Frau Grundlachs, wie sie nackt eine Treppe herunterkommt. Schild und Irene verlieben sich im Verlauf des Malprozesses, Irene hat Grundlach verlassen und ist jetzt Schilds Muse und Frau. Irene und Schild erfahren, dass das Bild, das nach wie vor in Grundlachs Haus hängt, beschädigt worden ist – vermutlich mutwillig von Grundlach. Schild will es zunächst reparieren, nach mehreren Zyklen ‚Beschädigung-Reparatur‘ will er es zurück. Der junge Anwalt wird von Schild involviert, weil Grundlach nach jedem Beschädigungsfall sich zunächst weigert, Schild die Reparatur zu erlauben. Schliesslich schlägt Grundlach einen Deal vor, der auf einen Tausch ‚Bild für Schild, Irene zurück zu Grundlach‘ hinausläuft. Trotz ethischen und beruflichen Bedenken willigt der Anwalt ein, einen entsprechenden Vertrag zu erstellen. Bei der Abwicklung des Deals wird der Anwalt zum Komplizen von Irene, in die er sich inzwischen verliebt hat, indem er dabei mitmacht, dass das Bild in den Besitz von Irene gelangt und sie sich von beiden Männern befreien kann. Aus der Liebe wird nichts, der junge Anwalt setzt seine Karriere in der Kanzlei fort, das Bild der Frau auf der Treppe und Irene verschwinden aus seinem Leben.
Viel, viel (40-50 Jahre?) später ist der Anwalt in Sydney. Er hat einen M&A-Deal erfolgreich abgeschlossen und besucht in der freien Zeit bis zu seinem Rückflug nach Frankfurt und in die Kanzlei, die dank seiner Kompetenz und seines Einsatzes sehr gross und international erfolgreich geworden ist, und an der er als führender Partner massgeblich beteiligt ist, die Art Gallery. Dort hängt – gemäss Angaben der Art Gallery als Leihgabe – die verschollen geglaubte Frau auf der Treppe des inzwischen äusserst erfolgreichen und international teuer gehandelten Malers Schwind. Der Anwalt wird von den dadurch ausgelösten Erinnerungen an die Episode, die am Anfang seiner Karriere stand und ihn beruflich beinahe völlig ruiniert hätte, überwältigt. Die Gallery weigert sich, ihm den Namen des Besitzers des Gemäldes bekannt zu geben. Er beauftragte eine lokale Detektei, den Besitzer und dessen Adresse ausfindig zu machen. Seine Rückreise nach Frankfurt verschiebt er um zwei Wochen. Als er erfährt, dass das Bild nach wie vor im Besitz von Irene ist, die unter ihrem Mädchennamen und illegal auf einer der australischen Ostküste vorgelagerten Insel lebt, will er sie unbedingt wiedersehen. Er findet sie tatsächlich. Sie hat die Ausstellung so arrangiert, dass ihre damaligen Männer Schwind und Grundlach darauf aufmerksam werden müssen, und sie rechnet damit, dass beide tatsächlich nach Australien kommen, um den alten, nach wie vor ausgelösten Konflikt zwischen ihnen endgültig zu bereinigen und zu begraben. Das Auftauchen des Anwalts war nicht geplant, ist Irene aber durchaus willkommen. Irene ist unübersehbar todkrank; der Anwalt wird ihr guter Samariter. Die Konfliktlösung gelingt natürlich nicht; Schwind und Grundlach verschwinden im von Grundlach gecharterten Helikopter sang- und klanglos. Der Anwalt bleibt zurück und begleitet Irene sehr einfühlsam und hilfsbereit in den Tod.
Diese letzten Tage von Irene ermöglichen ihr und dem Anwalt, den Faden ihrer vor langer Zeit zaghaft artikulierten, aber nie vollzogenen Liebe, die durch Irenes Verrat abrupt beendet worden war, wieder aufzunehmen.
In tiefen und tiefgründigen Gesprächen loten die beiden aus, wie ihr Leben hätte aussehen können, wenn sie beieinandergeblieben wären. In den Rückblenden auf ihr tatsächliches Leben und in der Potentialität ihres möglichen Lebens werden die Themen Besitz und Verlust, (bürgerliche) Geborgenheit und (Utopie-zentrierte) Abenteuerlust, Schein und Sein, Selbstverwirklichung und Entfremdung, Liebe und Konvention, Tod und Lebendigsein emotional und rational bearbeitet; beide erleben eine späte und tiefe Liebe, von der sie aber wissen, dass sie ohne die Erfahrungen, die beide unabhängig voneinander zwischen ihrer ersten und zweiten Begegnung gemacht haben, gar nicht möglich geworden wäre.
Bernhard Schlink ist ein grossartiges Werk gelungen. Der bewegende Gehalt des Buchs und die überzeugende Sprache Schlinks überwiegen bei weitem die Schwächen, die der Roman durchaus auch hat: ein sehr unwahrscheinlicher Plot; ein Held, der in seinem Leben als Schreibtischtäter wohl nie einen Schraubenzieher angefasst und sich nie sportlich-physisch betätigt hat, kann plötzlich im australischen Busch ein altes Haus und zerfallende Treppen reparieren und eine Frau über längere Distanzen tragen; unnötige, in ihrer Kürze und Beiläufigkeit jedenfalls deplatzierte Anspielungen auf RAF, Ostalgie, 68-er Mentalität, etc.