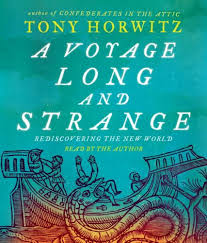
(on the Trail of Vikings, Conquistadors, Lost Colonists and Other Adventurers in Early America)
Tony Horwitz schreibt das Buch, weil er sich über die amerikanische ‚Geschichtslüge‘ ärgert, die amerikanische Geschichte hätte mit den sogenannten ‚Pilgrims Fathers‘ am Plymouth Rock begonnen – an dem diese 1620 gelandet sind.
Deshalb zeichnet er alle wesentlichen Forschungs- und Abenteuerexpeditionen nach, die erstmals – soweit wir wissen, und natürlich unter Ausklammerung der fälschlicherweise so bezeichneten ‚native Americans‘, die Tausende von Jahren früher über die Beringstrasse eingewandert sind – mit den Wikingern um das Jahr 1000 begonnen haben.
Er verfolgt die Spuren der spanischen Conquistadors, die bereits wenige Jahre nach der Entdeckung ‚Indiens‘ durch Kolumbus (in Tat und Wahrheit hatte er die Karibik entdeckt), also im frühen 16. Jahrhundert, weit nach Norden und tief in den nordamerikanischen Kontinent vorgestossen sind und dort erste dauerhafte europäische Siedlungen errichtet haben, lange bevor die englischen Einwanderer sich in Amerika niederliessen. Er zeigt, dass auch die Franzosen schon vor den Engländern da waren, und schildert die Geschichte und den Untergang deren Niederlassungen an der Ostküste des damals bereits spanischen Florida (Fort Caroline beim heutigen Jacksonville, und das heute noch bestehende St. Augustine).
Ebenso ruft er mit der Geschichte von «Roanoke» in Erinnerung, dass auch Engländer einige Jahrzehnte vor den Pilgrim Fathers versuchten, in Nordamerika, an der Chesapeake Bay, sesshaft zu werden. Die Schicksale von Walter Raleigh, John White, John Rolfe und Pocahontas – um nur wenige zu erwähnen – werden von Horwitz eindringlich, einfühlsam und lebendig zum Leben erweckt.
Für alle Versuche von Europäern, erfolglose und aus europäischer Sicht ‚erfolgreiche‘, gilt, dass sie für die bereits vorhandenen einheimischen Völker mit schrecklichen Folgen (importierte Krankheiten) und zahlreichen grässlichen Grausamkeiten verbunden waren. Horwitz schildert diese zwar unaufgeregt, aber ungeschminkt und in aller Deutlichkeit.
«A Voyage Long and Strange» ist eine Mischung von historischem und zeitgenössischem Reisebericht. Der Autor verfolgt nämlich buchstäblich die Spuren der weissen Eindringlinge und schildert sowohl die landschaftlichen, klimatischen, wirtschaftlichen Besonderheiten der be- und heimgesuchten Regionen und Völker als auch deren zivilisatorischen Zustand. Er begegnet dabei zahlreichen der wenigen Nachkommen der ‚Eingeborenen‘ beziehungsweise der Nachkommen der ‚Eroberer‘. Er zeigt auch, dass die Vermischung von Eingeborenen und Eindringlingen praktisch mit dem ersten Tag der Begegnung begonnen hat, und dass es deshalb heute schwierig ist, klare oder gar ‚reine‘ Linien zwischen den Menschen des 16./17. Jahrhunderts und heutigen Zeitgenossen zu ziehen.
Mit zunehmender Dauer seiner Nachforschungen wird Horwitz immer stärker bewusst, dass seine ursprüngliche Absicht, die Geschichtslüge Amerikas zu entlarven und die Menschen dafür zu gewinnen, mit der Geschichte dort zu beginnen, wo sie tatsächlich angefangen hat, ein hoffnungsloses Unterfangen ist.
Schliesslich schliesst er Frieden mit dem Widerspruch zwischen Tatsachen und Mythen. In Plymouth, ausgerechnet an einer Feier zum Jahrestag der Ankunft der Pilgrim Fathers, begegnet ihm ‚Reverend Gomes‘, Prediger an der Harvard Memorial Church. Gomes ist ein in Plymouth aufgewachsener dunkelhäutiger Abkomme von Afro-Amerikanern und Portugiesen von den Kapverdischen Inseln. Er vertritt den Standpunkt: «Growing up here, we were given a useful distinction between symbol and reality. The Rock, like many icons, is important not because it’s big and impressive, but because of what it represents. … Myth is more important than history. History is arbitrary, a collection of facts. Myth we choose, we create, we perpetuate. … The story here may not be correct, but it transcends truth. It’s like religion – beyond facts. Myth trumps fact, always does, always has, always will.»
Die Lektüre des Berichts von Horwitz ist äusserst interessant, lehrreich und öffnet einem die Augen für eine auch in Europa meist vergessene oder ignorierte Epoche der nordamerikanischen Geschichte, die für weite Teile der USA identitätsstiftend war und bleibt. Ausserdem sind die meisten der geschilderten Begegnungen mit Menschen, die sich mit diesem Teil der Geschichte auseinandersetzen oder immer noch daran leiden, sowohl sehr amüsant als auch eindrücklich.