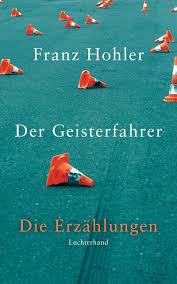
Der Band «Der Geisterfahrer», erschienen zu Hohlers 70. Geburtstag (2013), vereinigt alle längeren Erzählungen, die er über einen Zeitraum von rund 40 Jahren in früheren Bänden wie «Der Rand von Ostermundigen», «Die Rückeroberung», «Die Torte» und «Der Stein» veröffentlicht hat. Er gibt einen chronologischen Gesamteindruck der künstlerischen Entwicklung und des erzählerischen Könnens Hohlers.
Ich bin ausserordentlich beeindruckt von Hohlers sprachlicher Virtuosität und von seiner überbordenden Fantasie, Er entführt damit Leserinnen und Lesern in Welten, die ihren Ursprung oder Anlass zwar in der banalen Wirklichkeit haben, aber weit über die Wirklichkeit hinaus Bedeutungen erlangen und Wirkungen entfalten, die fesseln, nachdenklich stimmen oder neue Einsichten und Wertungen anstossen.
Hohler erzählt die verrücktesten Geschichten ohne jede Aufgeregtheit. Die Texte wirken, wie wenn er einfach drauflos erzählen würde (nachdem er wahrscheinlich jedes Wort genau überlegt und gesetzt hat). Er benötigt weder Holzhammer noch Droh- oder Mahnfinger. Er schreibt – die Wirkung und Deutung überlässt er Leserinnen und Lesern.
Wenn Hohler Dinge in seine Geschichten einflicht, die nicht alltäglich sind, recherchiert er so minutiös, dass er wie ein Fachmann daherkommt. Am eindrücklichsten – finde ich – ist das in «Bianca Carnevale». Diese Geschichte kann eigentlich nur von einem professionellen Pianisten geschrieben worden sein; so einfühlsam und präzis sind die Schilderungen des Konzertierens am Flügel, oder die Technik des Notenblätterns, oder die Textualisierung einzelner Musikstücke.
Die Wirkung von Hohlers Erzählungen ist geradezu ‚invasiv’. Er lässt einen nicht mehr los. Bilder aus den Erzählungen steigen auch im Alltag immer wieder hoch. Beispiele:
- Der Geisterfahrer zwischen Egerkingen und Kestenholz (der Roggenbauer, der auf der Autobahn mit seinem Heufuder seinen zugebauten Grenzstein wieder setzen will) verfolgt mich nicht nur, wenn ich daran denke, auf der A1 von Zürich Richtung Bern zu fahren. Auf jeder abgesperrten Baustelle, an der niemand arbeitet, suche ich mit einem Seitenblick den Grenzstein, der zur Beruhigung eines unruhigen Geistes wieder an seinen ursprünglichen Ort gesetzt werden musste.
- In unserer Waschküche in Bever liegt seit etwa einem Jahr ein Paar schwarze Damenleggins (also ‚fusslose Strumpfhosen‘) herum, die ich beim Leeren der Waschmaschine gefunden und in unsere Wohnung gebracht hatte, weil ich annahm, sie gehörten meiner Frau. Als meine Frau dies verneinte, legte ich sie in die Waschküche zurück; sie musste doch einer anderen Bewohnerfamilie gehören. Seit ich «Das Kleid» gelesen habe, erwarte ich jedes Mal, wenn ich in der Waschküche zu tun habe, dass das dazu passende Oberteil auftauchen muss, oder gar die zu den Leggins gehörende Frau. Wenn ich an der geschlossenen Waschküchentür vorbeigehe, muss ich mich manchmal beherrschen, nicht die Tür zu öffnen und nachzusehen, ob das Rätsel der herren- beziehungsweise damenlosen Leggins endlich gelöst ist.
- Normalerweise käme ich nie auf die Idee, einer Bank etwas zu schenken. Aber seit Hohlers «Die Schenkung» ertappe ich mich dabei, bei Bankgeschäften extra aufzupassen, dass ich dabei ja nicht zugunsten der Bank zu kurz kommen könnte. Die Komplikationen, die der Erzähler wegen eines seiner Bank geschenkten Rappens erdulden muss, will ich mir unbedingt ersparen.
- Der ‚Superthronger’ aus «Ein ganz schwerer Transport» ist für mein argloses Gemüt ebenfalls eine schwere Belastung. Erstens weiss ich immer noch nicht, was ein Superthronger ist. Google hilft auch nicht weiter, denn als Suchergebnis taucht immer wieder Hohlers Erzählung auf. Zweitens beginnt es in meinem Kopf heftig zu rumoren, wenn ich einem Schwertransport begegne. Sofort fesseln mich Fragen wie: Ist Herr Lätt jetzt doch wieder unterwegs? Oder hat er einen Nachfolger gefunden? Oder sucht sich ein neues superschweres Gerät eine Durchfahrt über sichere Brücken, genügend hohe Unterführungen? Der Bagger, der neulich auf der A1 bei Birmenstorf eine Autobahnbrücke abbruchreif beschädigt hat, vereinfacht die Geschichte natürlich nicht.
- Der Adler, den ich im Engadin beobachte – vielleicht ist es auch ein Geier; für einen Engadiner mit Migrationshintergrund sind die Unterschiede ja nicht offensichtlich –, weckt unwillkürlich Überlegungen wie: Warum ist der nicht in Zürich in der Altstadt und frisst Katzen? Ist er krank und findet den Weg nach Zürich nicht? Zeigt das Tier an, dass auch im Engadin die Rückeroberung beginnt? Wie lange dauert es noch, bis alle Transportanlagen und alle Gebäude von Waldreben überwuchert und Wolf, Bär und Biber wieder im ganzen Tal heimisch sind, und das ganze Tal neuerdings zum Nationalpark gehört. Umgekehrt lässt mich «Die Rückeroberung», wenn ich in Zürich bin und beispielsweise die Rathausbrücke überquere, reflexartig in die Limmat schauen und Nilpferde und Krokodile suchen.
Das sind Beispiele für das, was ich an Hohlers Erzählungen ‚invasiv’ finde.
Roger Willemsen bestätigt meine Eindrücke am Schluss seines Nachworts zum Sammelband:
«… Und Vorsicht, die Welt des Franz Hohler wirkt weiter. Sie entlässt uns nicht, wir gehen auf die Strasse, und da ist sie schon und will weitererzählt werden: Ein Fundstück auf der Strasse, ein vorbeifliegender Satz, ein verirrtes Signal – schon sind wir mittendrin in diesem Jenseits.»